Für die Stadtwerke Uelzen steht die Versorgungssicherheit von Strom, Erdgas und Trinkwasser in der Hansestadt Uelzen an erster Stelle. Dabei sehen wir uns in der Verantwortung eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung voranzutreiben. Wie wichtig das ist, haben uns die vergangenen Jahre gezeigt.
Gegenwärtig ist die Energieversorgung in Deutschland stabil. Doch auch wenn sich die Lage auf den Energiemärkten vorerst entspannt hat, bleibt ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen wichtig.
Hier finden Sie alle aktuellen Informationen zur Lage bei mycity und weitere Neuigkeiten zum Unternehmensgeschehen.
Der Sommer steht ins Land, die ersten warmen Sonnentage konnten wir schon genießen. Endlich wieder Zeit für gemütliche Grillabende mit Freunden, lange Spaziergänge durch die grüne Natur – oder fröhliche Stunden im Freibad. Am 14. Mai haben wir die Saison im BADUE eröffnet und freuen uns dort auf viele Gäste und eine lebendige Saison.
Nicht nur dafür hoffen wir auf viel Sonnenschein – ebenfalls für unsere zahlreichen PV-Anlagen und -Parks, die damit für regenerative Energie sorgen. So wie beispielsweise der PV-Park an der Justizvollzugsanstalt Uelzen, den wir 2023 in Betrieb genommen haben. Nach anfänglichen Herausforderungen, erwarten wir in diesem Jahr eine volle CO2-Einsparung von mehr als 2.500 Tonnen. Zudem freuen wir uns über eine weitere PV-Anlage, die seit dem 1. Januar 2024 für noch mehr Solarenergie in der Hansestadt sorgt. Umgesetzt haben wir das Projekt mit der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG, dem Hersteller von Büroprodukten, an seinem Produktionsstandort Uelzen. Die Anlage wird etwa 700.000 kWh grünen Strom im Jahr produzieren, der zur Versorgung des Unternehmens genutzt wird.
Aber auch für unsere Energiekund*innen haben wir interessante Neuigkeiten mit unseren neuen mycity Strom- und Gasprodukten. Seit Anfang April bieten diese mit stabilen Konditionen und einer Erstlaufzeit bis zum 31.03.2026 Planungssicherheit für den privaten Haushalts-Etat.
Damit starten wir optimistisch in die Mitte des Jahres 2024 und drücken die Daumen für einen schönen Sommer! (Stand 14.05.2024)
Die MwSt. auf Erdgas die seitdem 01.10.22 reduziert wurde, wird ab dem 01.01.24 wieder auf 19 % angehoben.
Zur längerfristigen Dämpfung der Belastungen durch gestiegene Energiekosten hat die Bundesregierung die Erdgaspreisbremse eingeführt. Damit zahlen Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen, die weniger als 1,5 Mio kWh Erdgas im Jahr verbrauchen, für 80 Prozent ihres im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs einen maximalen Bruttoarbeitspreis von 12,00 ct/kWh. Die Differenz zum vereinbarten Tarif-Arbeitspreis übernimmt der Staat. Das gilt auch für die Grund- und Ersatzversorgung. Für den darüberhinausgehenden tatsächlichen Verbrauch wird der vertraglich vereinbarte Tarifarbeitspreis fällig. Die Erdgaspreisbremse gilt aktuell vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Bundesnetzagentur.
Als Folge aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, wurde die ursprünglich bereits beschlossene Verlängerung der staatlichen Preisbremse für Strom und Gas zum Jahresende 2023 eingestellt.
In Anbetracht dieser politischen Widrigkeiten, sehen wir uns als kommunaler Energieversorger umso mehr in der Pflicht, für unsere Kund*innen umsichtig und verantwortungsvoll zu handeln. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass die vereinbarte Deckelung für 80% Ihrer Energieverbrauchsmenge bis zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit im September 2024 weiterhin garantiert ist. Zusatzbelastungen durch wegfallende staatliche Förderungen trägt mycity.
Zur längerfristigen Dämpfung der Belastungen durch gestiegene Energiekosten hat die Bundesregierung die Strompreisbremse eingeführt. Damit zahlen Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen, die weniger als 30.000 kWh Strom im Jahr verbrauchen, für 80 Prozent ihres vom Netzbetreiber prognostizierten Jahresverbrauchs einen maximalen Bruttoarbeitspreis von 40,00 ct/kWh. Die Differenz zum vereinbarten Tarif-Arbeitspreis übernimmt der Staat. Das gilt auch für die Grund- und Ersatzversorgung. Für den darüber hinausgehenden tatsächlichen Verbrauch wird der vertraglich vereinbarte Tarifarbeitspreis fällig. Die Strompreisbremse gilt aktuell vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Bundesnetzagentur.
Laut der Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung in Deutschland aktuell stabil und die Ausgangslage für diesen Winter deutlich besser als vor einem Jahr.
Hier finden Sie unsere Tipps zum Energie sparen.
Wir entwickeln bereits neue Produktlösungen und werden frühzeitig mit Verlängerungsoptionen zu bestmöglichen Konditionen ab dem 01.10.2024 auf Sie zukommen.
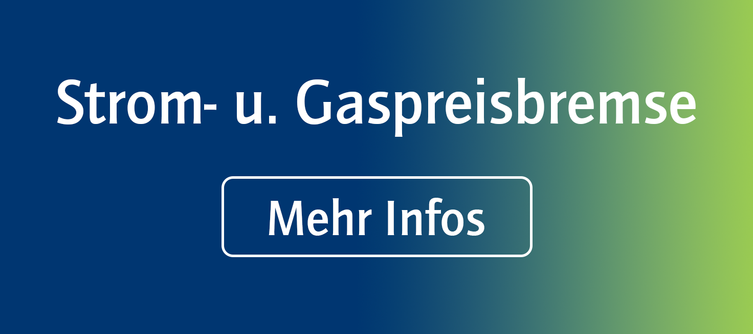
Sie benötigen weitere Informationen zu den Themen Strom- und Gaspreisbremse?
Informationen & Erklärungen
Fragen & Antworten Strompreisbremse
Fragen & Antworten Gaspreisbremse